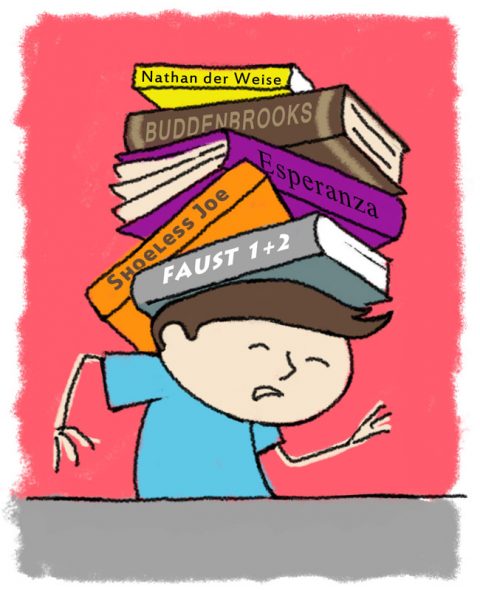Vorschau:
Vergangenen Freitag endete die erste Staffel „Star Trek: Picard“ im Fernsehen. Dieses Blog ist, mal abgesehen von der Reihe „Physik von Hollywood„, nicht so sehr dafür bekannt, sich intensiv mit Literatur, Funk und Fernsehen auseinanderzusetzen. Andererseits ist das Bestreben einer jeden Kunstform, eine Wirkung zu erzeugen. Bücher, die etwas im Leser verändern, vielleicht zum Positiven bewegen, sind es wert, dass man über sie spricht. Filme, die eine Diskussion auslösen (wie bspw. „Systemsprenger„) haben eine größere Bühne verdient. Zwei rote Fäden ziehen sich durch „Picard“. Erstens: Lange vor Einsetzen der Handlung wurden hunderte Millionen Romulaner durch die Explosion ihrer Heimatsonne zu Flüchtlingen. Die (menschliche) Föderation wurde ihrem positiven Selbstbild nicht gerecht und ignorierte dieses Leid aus Angst um das eigene Wohlergehen. Zweitens: Die Hauptfigur, Jean-Luc Picard, kämpft nicht nur mit dem Verrat an diesen Idealen, sondern auch mit dem Tod eines guten Freundes viele Jahre zuvor. Aus dieser Trauer resultiert eine Passivität und Starre, die sich mit Einsetzen der Serie auflöst. Die alte Welt Als ich im Januar über die erste Folge schrieb, war die Welt noch eine andere: Alle Kinder gingen noch in die Schule und im wöchentlichen Rhythmus begeisterten oder enttäuschten die Fußballergebnisse. Im Fokus der Aufmerksamkeit stand die entsetzliche Flüchtlingswelle aus Syrien und die unwürdige Situation in den Auffanglagern. Im Fokus die Anklagen gegen die Kapitäne von Seenotschiffen. Gute Geschichten, auch gute ScienceFiction-Geschichten halten der Welt einen Spiegel vor. So geschickt, dass man es...
Vergangenen Freitag endete die erste Staffel „Star Trek: Picard“ im Fernsehen. Dieses Blog ist, mal abgesehen von der Reihe „Physik von Hollywood„, nicht so sehr dafür bekannt, sich intensiv mit Literatur, Funk und Fernsehen auseinanderzusetzen. Andererseits ist das Bestreben einer jeden Kunstform, eine Wirkung zu erzeugen. Bücher, die etwas im Leser verändern, vielleicht zum Positiven bewegen, sind es wert, dass man über sie spricht. Filme, die eine Diskussion auslösen (wie bspw. „Systemsprenger„) haben eine größere Bühne verdient. Zwei rote Fäden ziehen sich durch „Picard“. Erstens: Lange vor Einsetzen der Handlung wurden hunderte Millionen Romulaner durch die Explosion ihrer Heimatsonne zu Flüchtlingen. Die (menschliche) Föderation wurde ihrem positiven Selbstbild nicht gerecht und ignorierte dieses Leid aus Angst um das eigene Wohlergehen. Zweitens: Die Hauptfigur, Jean-Luc Picard, kämpft nicht nur mit dem Verrat an diesen Idealen, sondern auch mit dem Tod eines guten Freundes viele Jahre zuvor. Aus dieser Trauer resultiert eine Passivität und Starre, die sich mit Einsetzen der Serie auflöst. Die alte Welt Als ich im Januar über die erste Folge schrieb, war die Welt noch eine andere: Alle Kinder gingen noch in die Schule und im wöchentlichen Rhythmus begeisterten oder enttäuschten die Fußballergebnisse. Im Fokus der Aufmerksamkeit stand die entsetzliche Flüchtlingswelle aus Syrien und die unwürdige Situation in den Auffanglagern. Im Fokus die Anklagen gegen die Kapitäne von Seenotschiffen. Gute Geschichten, auch gute ScienceFiction-Geschichten halten der Welt einen Spiegel vor. So geschickt, dass man es...
Zum vollständigen Beitrag: „Angst ist ein unfähiger Lehrer.“
https://halbtagsblog.de/2020/03/28/angst_ist_ein_unfaehiger_lehrer/