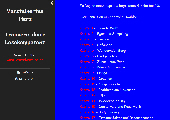Vorschau:
Die Entwicklung der Lesekompetenz ist ein übergeordnetes Ziel des schulischen Unterrichts. Bereits vor der Einschulung wird in den allermeisten Fällen auf den Erwerb basaler Lesekenntnisse hingewirkt – und das nicht ohne Grund. In einer (digitalen) Schriftkultur ist gesellschaftliche Teilhabe ohne ausgeprägte Lesekompetenz kaum möglich. Doch was genau wird darunter verstanden und wie kann sie gefördert werden? Was ist Lesekompetenz? Der Begriff der Lesekompetenz ist heute klar definiert. So versteht die OECD darunter die Fähigkeit, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“. Auffällig ist hierbei der Umstand, dass die Lesekompetenz über die reine Fähigkeit, etwas zu lesen, hinausgeht: Lesekompetenz geht über den reinen Akt erfolgreichen Lesens hinaus und bezieht sich als Fähigkeit auch auf die Reflexion des Gelesenen sowie auf seine Instrumentalisierung in unterschiedlichen Kontexten. Zentral berührt ist damit auch einer der Hauptgründe für die Bedeutung von Lesekompetenz: Wer lesen kann, erschließt sich neue Möglichkeiten. So lässt sich das eigene Wissen erweitern und gesellschaftliche Teilhabe erreichen, aber auch bisherige Wertungsschemata reflektieren und neue Perspektiven auf unterschiedlichste Gegenstände erschließen respektive eröffnen. Stufen der Lesekompetenz Im schulischen Kontext wird die Lesekompetenz nicht nur gefördert, sondern auch beständig gemessen. Diese Messung wiederum wird als Bedingung der Möglichkeit individueller Förderung verstanden: Nur, wenn das individuelle Level der Lesekompetenz bekannt ist, kann zielgerichtet eingegriffen werden. Aus diesem Grund werden insgesamt fünf Stufen der Lesekompetenz unterschieden, die jeweils wesentliche Fertigkeiten umfassen. Stufe 1: Elementarstufe Die erste Kompetenzstufe umfasst Basisfertigkeiten. Die Schüler:innen sind in der Lage, klar benannte Informationen zu ermitteln, den Hauptgedanken eines Textes zu erfassen und einfache Verbindungen zwischen Text und Alltagswissen herzustellen. Das gilt jedoch nur für sehr einfache Texte und bei sehr expliziter Aufgabenstellung. Stufe 2: Einfache Verknüpfungen In der zweiten Kompetenzstufe besteht ein größeres Bewusstsein hinsichtlich der Verknüpfung verschiedener textueller sowie textueller mit außertextuellen Inhalten. Die Schüler:innen können wesentliche Informationen auch bei höherer Informationsdichte ermitteln, den Hauptgedanken des Textes benennen und einfache Argumentationen nachvollziehen sowie den Inhalt des Textes mit...
Die Entwicklung der Lesekompetenz ist ein übergeordnetes Ziel des schulischen Unterrichts. Bereits vor der Einschulung wird in den allermeisten Fällen auf den Erwerb basaler Lesekenntnisse hingewirkt – und das nicht ohne Grund. In einer (digitalen) Schriftkultur ist gesellschaftliche Teilhabe ohne ausgeprägte Lesekompetenz kaum möglich. Doch was genau wird darunter verstanden und wie kann sie gefördert werden? Was ist Lesekompetenz? Der Begriff der Lesekompetenz ist heute klar definiert. So versteht die OECD darunter die Fähigkeit, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“. Auffällig ist hierbei der Umstand, dass die Lesekompetenz über die reine Fähigkeit, etwas zu lesen, hinausgeht: Lesekompetenz geht über den reinen Akt erfolgreichen Lesens hinaus und bezieht sich als Fähigkeit auch auf die Reflexion des Gelesenen sowie auf seine Instrumentalisierung in unterschiedlichen Kontexten. Zentral berührt ist damit auch einer der Hauptgründe für die Bedeutung von Lesekompetenz: Wer lesen kann, erschließt sich neue Möglichkeiten. So lässt sich das eigene Wissen erweitern und gesellschaftliche Teilhabe erreichen, aber auch bisherige Wertungsschemata reflektieren und neue Perspektiven auf unterschiedlichste Gegenstände erschließen respektive eröffnen. Stufen der Lesekompetenz Im schulischen Kontext wird die Lesekompetenz nicht nur gefördert, sondern auch beständig gemessen. Diese Messung wiederum wird als Bedingung der Möglichkeit individueller Förderung verstanden: Nur, wenn das individuelle Level der Lesekompetenz bekannt ist, kann zielgerichtet eingegriffen werden. Aus diesem Grund werden insgesamt fünf Stufen der Lesekompetenz unterschieden, die jeweils wesentliche Fertigkeiten umfassen. Stufe 1: Elementarstufe Die erste Kompetenzstufe umfasst Basisfertigkeiten. Die Schüler:innen sind in der Lage, klar benannte Informationen zu ermitteln, den Hauptgedanken eines Textes zu erfassen und einfache Verbindungen zwischen Text und Alltagswissen herzustellen. Das gilt jedoch nur für sehr einfache Texte und bei sehr expliziter Aufgabenstellung. Stufe 2: Einfache Verknüpfungen In der zweiten Kompetenzstufe besteht ein größeres Bewusstsein hinsichtlich der Verknüpfung verschiedener textueller sowie textueller mit außertextuellen Inhalten. Die Schüler:innen können wesentliche Informationen auch bei höherer Informationsdichte ermitteln, den Hauptgedanken des Textes benennen und einfache Argumentationen nachvollziehen sowie den Inhalt des Textes mit...
Zum vollständigen Beitrag: Lesekompetenz in Theorie und Unterricht
https://www.lehrer24.net/unterricht/lesekompetenz-in-theorie-und-unterricht/